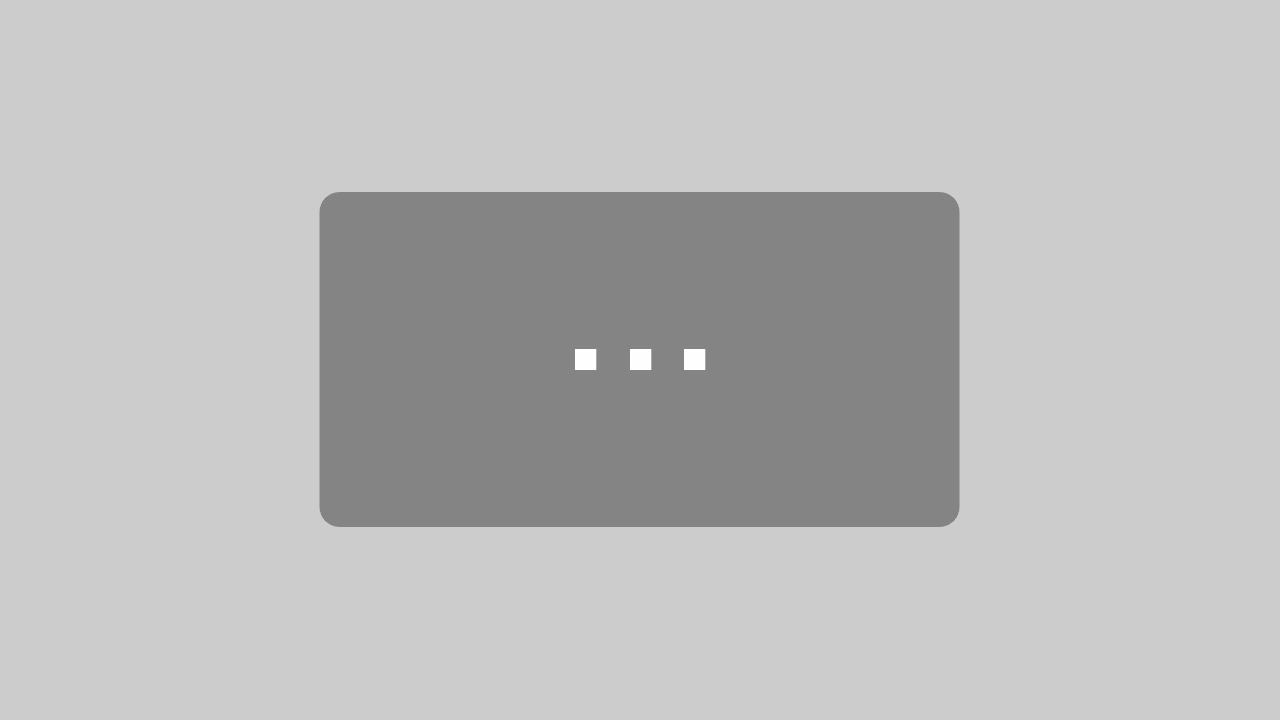Von Hans Hofmann-Reinecke
Nietzsche hatte unrecht. Wir haben Gott zwar getötet, ihn aber nicht durch den Mut zur Nutzung des eigenen Verstandes ersetzt! So leben wir heute in einer Epoche gottloser Dummheit, beherrscht von ideologischer Politik. Unsere kirchlichen, akademischen und industriellen Eliten sehen diesem Verfall tatenlos zu. Doch endlich bäumt sich der Teil der Gesellschaft auf, in dem das gesagte Wort noch gilt, wo Männer und Frauen noch tüchtig sein müssen, wo man den Freunden vertraut und den Feind bekämpft; wo man Tag und Nacht die raue Wirklichkeit vor Augen hat, und nicht nur Twitter und Facebook.
Ist Ehre noch zeitgemäß?
Welches Gefühl befällt Sie beim Lesen der folgenden Worte? Glaube – Schönheit – Ehre – Weisheit – Pflicht – Vaterland. Falls jemand zugehört haben sollte, wird man Sie jetzt mit Verwunderung fragen, was das soll. Diese Dinge sind doch so was von gestern.
Schauen wir uns aber das Abendland der letzten 3000 Jahre an, dann gab es nirgends und niemals eine Epoche, in der eine dieser Tugenden verachtet wurde. Natürlich hat mancher nur so getan als ob; natürlich waren viele Menschen weder schön noch weise, natürlich haben viele ihre Pflicht vernachlässigt oder ihr Vaterland verlassen. Die Färbung dieser Begriffe aber war stets positiv, und jeder hat Anstrengungen unternommen, einen Beitrag zu leisten, oder zumindest den Anschein zu erwecken; alles andere wäre als „ehrlos“ oder „schamlos“ empfunden worden.
Das Abendland hat in diesen 3000 Jahren viel geschaffen, das vom Rest der Welt gerne und ohne Zwang übernommen wurde. Und es könnte sein, dass die eingangs aufgezählten Tugenden mit dieser Überlegenheit im Zusammenhang stehen. Die politisch-mediale Elite der Gegenwart sieht das jedoch anders: 3000 Jahre lang war das Abendland auf dem Holzweg. 3000 Jahre lang, von Pythagoras bis Picasso, von Homer bis Hemingway hat man alles falsch gemacht. Die klassischen Tugenden sind heute bestenfalls peinlich, wenn nicht gleich Nazi.
Ich bin alt genug, um die Zeit vor und nach dieser Wende als Erwachsener miterlebt zu haben; und nicht nur das. Wie jemand sich verändert wird besonders deutlich, wenn man ihn längere Zeit nicht sieht. So konnte ich durch Jahre im Ausland bei meinen Besuchen der alten Heimat deren Wandel wie im Zeitraffer erkennen. Und ich sah , wie diese „Wertewende“ eine galoppierende gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Dekadenz ausgelöst hatte . „Nietsche hatte unrecht“ weiterlesen